Im Bereich der Videoüberwachung eröffnen sich für Unternehmen zahlreiche Vorteile – von der Prävention bis zur Aufklärung von Straftaten. Doch mit diesen Vorteilen kommen auch komplexe Herausforderungen im Datenschutz, die nicht unterschätzt werden sollten. Bei Datenschutzverstößen drohen nicht nur Imageschäden, sondern auch erhebliche Bußgelder. Ein Beispiel hierfür ist die notebooksbilliger.de AG, die ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Mio. Euro erhalten hat.Genau hier setzt unsere Datenschutzberatung an: Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl die Sicherheitsinteressen Ihres Unternehmens als auch die Datenschutzrechte der Einzelnen wahren. Unsere Expertise ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir sicherstellen, dass Ihre Videoüberwachungspraktiken vollständig konform mit den aktuellen Datenschutzgesetzen sind. In diesem Beitrag beleuchten wir die Schlüsselelemente einer rechtskonformen Videoüberwachung und wie wir Ihnen helfen können, die Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz zu meistern.
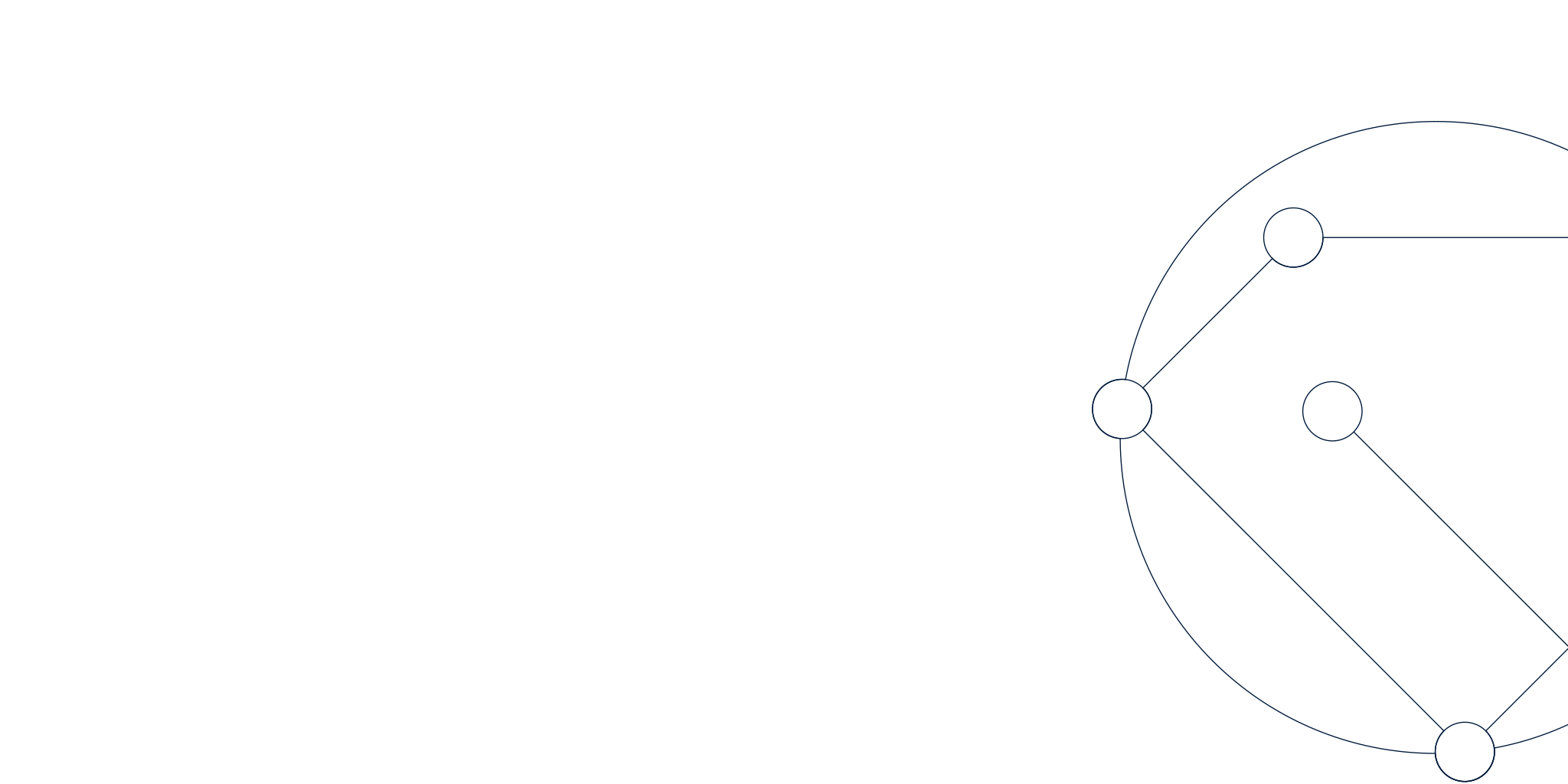
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle Beratung zu Ihren Anforderungen an Videoüberwachung und Datenschutz. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für eine sichere und rechtskonforme Lösung.
Was ist Videoüberwachung?
Datenschutzrechtlich liegt eine Videoüberwachung immer vor, sobald mit Kameras personenbezogene Daten verarbeitet werden. Damit sind zum einen nicht nur herkömmliche Überwachungskameras, sondern auch alle anderen Kameras wie Handykameras, Webcams oder Drohnen erfasst. Zum anderen muss mit der Kamera nicht einmal ein Überwachungszweck verfolgt werden, sondern es kommt vielmehr darauf an, ob tatsächlich gefilmt wird. Bloße Kameraattrappen nehmen hingegen keine personenbezogenen Daten auf und sind zumindest datenschutzrechtlich nichtrelevant. Die Aufnahmen müssen schließlich auch nicht aufgezeichnet werden, denn schon die Live-Übertragung, die auf Bildschirmen verfolgt und nicht gespeichert wird, stellt eine Videoüberwachung dar. Es kommt daher allein auf die Aufnahme an sich an, sodass die Aufnahmen nicht einmal von jemandem angesehen werden müssen, bevor sie gelöscht werden. Der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, welches das Datenschutzrecht schützt, liegt bereits mit der Aufnahme vor.
Die rechtlichen Herausforderungen der Videoüberwachung in öffentlichen und privaten Räumen
Datenschutzrecht ist deshalb einschlägig, da Videoaufnahmen von Personen die Erfassung personenbezogener Daten bedeuten, sobald auf ihnen Personen eindeutig erkennbar oder auch nur Hinweise auf ihre Identität enthalten sind. Bereits die über die Kamera sichtbare Information, dass sich eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufgehalten hat, kann ein personenbezogenes Datum darstellen.
Der Umstand, gefilmt zu werden, greift fast immer in sensible Persönlichkeitsbereiche ein. Der freie und unbeobachtete Aufenthalt im öffentlichen Raum ist daher ein Recht, in das nicht uneingeschränkt eingegriffen werden kann. Die Vielzahl von Überwachungskameras, ihre teils geringe Größe oder ihre Positionierung können sogar dazu führen, dass die gefilmten Personen sich der Überwachung gar nicht erst bewusst sind. Zudem ermöglichen neue, innovative, technische Lösungen Bilder von extrem hoher Auflösung. Personen können durch schwenkbare Kameras genau verfolgt oder mittels Gesichtserkennungssoftware identifiziert werden. Inzwischen ist es bereits möglich, dass eine Software die Identifikation einer Person am Gang vornehmen kann. Darüber hinaus stellt es technisch längst kein Problem mehr dar, große Mengen an Videomaterial über sehr lange Zeiträume zu speichern. Damit geht ein höheres Risiko immer stärkerer Eingriffe in Grundrechte einher, seien es zum Beispiel die von Mitarbeitern eines Unternehmens, von Gästen oder von anderen Personen. Es muss daher eine Reihe gesetzlicher Vorgaben beachtet werden. Diese variieren auch abhängig vom jeweiligen Kontext, in dem die Videoüberwachung eingesetzt wird. Während es unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen für die Überwachung öffentlicher und nichtöffentlicher Räume gibt, gilt die DSGVO für Videoaufnahmen im rein privaten Bereich gar nicht. Die private Videoüberwachung öffentlicher Räume kann allerdings unter einen Straftatbestand fallen, etwa die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen nach § 201a Strafgesetzbuch (StGB).
Rechtsgrundlagen der Videoüberwachung: Anwendungsbereiche und Datenschutzbestimmungen nach Art. 6 DSGVO
Wie bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten ist eine Rechtsgrundlage für ihre Rechtmäßigkeit notwendig. An sich kommen alle gesetzlichen Rechtsgrundlagen des Art. 6 DSGVO in Betracht, für die Videoüberwachung am gängigsten dürften jedoch die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten nach Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO sein. Allerdings ist es möglich, dass im Beschäftigungsverhältnis oder bei der Erfassung von Gesundheitsdaten höhere Anforderungen und andere Rechtsgrundlagen einschlägig sein können.
Zielsetzung der Videoüberwachung: Die Notwendigkeit präziser Zweckbestimmung für jede Kamera
Zunächst sollten die Zwecke festgelegt werden, die mit der Videoüberwachung verfolgt werden. Hier ist wichtig, dass nicht die Zwecke für die Videoüberwachung insgesamt, sondern für jede einzelne Kamera gesondert benannt werden müssen. Zudem sollten die Zwecke möglichst konkret beschrieben werden und Beschreibungen wie „als Schutzmaßnahme“ oder „aus Gründen der Sicherheit“ nicht allein stehengelassen werden. In Betracht kommt hierbei etwa der bereits angesprochene Eigentumsschutz oder der Schutz vor körperlichen Angriffen.
Videoüberwachung im Spannungsfeld von berechtigtem Interesse und Datenschutz gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
Die Videoüberwachung kann nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO rechtmäßig sein, wenn das Unternehmen mit ihr ein berechtigtes Interesse verfolgt. Das Interesse kann dabei rechtlicher, wirtschaftlicher, aber auch ideeller Natur sein. Die Vorbeugung von Straftaten bzw. Angriffen gegen das Eigentum oder Personen gehören genauso dazu wie die Beweissicherung durch den Inhaber des Hausrechts. Hierzu ist es grundsätzlich erforderlich, dass eine konkrete Gefahrenlage vorliegt, die sich auf konkrete Hinweise und objektive Tatsachen gründet, etwa wenn es auf dem Grundstück bereits in der Vergangenheit Vorfälle gegeben hat. Es ist aber auch möglich zu argumentieren, dass die Umstände im konkreten Fall typischerweise eine Gefahrensituation anzeigen, wie es zum Beispiel in einer Bankfiliale oder einem Lager mit besonders wertvollen Waren der Fall sein kann.
Zu den Voraussetzungen dieser Rechtsgrundlage gehören die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Videoüberwachung für den geeigneten Zweck. Dass die Videoüberwachung für die Zwecke geeignet ist, kann in aller Regel bejaht werden. Damit die Videoüberwachung erforderlich ist, darf es kein Mittel geben, das gleich geeignet ist und dabei weniger in die Rechte der betroffenen Personen eingreift. Hier sollte vor allem geprüft werden, dass der Zweck genau zur jeweiligen Maßnahme passt und nicht zum Beispiel Livekameras ohne Aufzeichnung zur Beweissicherung eingesetzt oder (nur) die Bereiche, in denen Vorkommnisse erwartet werden, im Blickfeld der Kamera liegen. Als alternative Maßnahmen sollte unter anderem der Einsatz von Sicherheitspersonal, einbruchsicherer Türen und Fenster oder Alarmanlagen bedacht werden.
Schließlich müssen die Rechte, Freiheiten und Interessen der betroffenen Personen mit den Interessen des Verantwortlichen abgewogen werden (Verhältnismäßigkeit der Videoüberwachung). Am besten wird die Eingriffsintensität der Videoüberwachung so weit beschränkt, wie es im Einklang mit dem verfolgten Zweck möglich ist. Auch ein strenges Löschkonzept wirkt sich auf die Abwägung positiv aus. Für die Abwägung können zudem folgende Umstände relevant sein: Kinder, die aufgenommen werden, sind in der Regel besonders schutzbedürftig. Bereiche wie Kantinen oder Sporträumlichkeiten sind sensibler einzustufen, und die Intimsphäre berührende Umgebungen wie Umkleiden und Toiletten dürfen grundsätzlich gar nicht gefilmt werden. Maßgeblich ist auch, welche Rechtsgüter geschützt werden: Am Schutz von Leib und Leben oder wertvollem Eigentum besteht ein höheres Interesse als geringwertiger Gegenstände. Weiterhin ist wichtig, welche Informationen erfasst werden, ob ein Ton aufgenommen wird und Gespräche erfasst werden, wie groß der Aufnahmebereich ist und ob Personen den Kameras ausweichen können. Hier sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und alle relevanten Punkte sauber zu dokumentieren.
Die Grenzen der Einwilligung als Rechtsgrundlage für Videoüberwachung gemäß DSGVO
Die Einwilligung nach der DSGVO ist die vorherige Zustimmung durch eine freiwillige und informiert getroffene Erklärung. Für die Videoüberwachung ist die Einholung einer Einwilligung der Gefilmten jedoch meist nicht möglich, da sie von unbeteiligten, im Vorfeld unbekannten Personen, die sich in den gefilmten Bereich begeben, praktisch nicht vorher eingeholt werden kann. Für die Erklärung der Einwilligung vor dem Betreten des gefilmten Geländes kann zudem die Freiwilligkeit fraglich sein. Auch das jederzeitige Recht auf Widerruf der Einwilligung wird häufig nicht umsetzbar sein, weshalb die Einwilligung als Rechtsgrundlage einer Videoüberwachung eher ungeeignet ist. Dies gilt zumeist auch für die Videoüberwachung auf der Grundlage eines Vertrags nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da eine Videoüberwachung unbeteiligter Personen in der Regel nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit diesen erforderlich sein wird.
Das könnte Sie auch interessieren
- Die Betroffenenrechte nach der DSGVO: Ein Überblick
- Fragen und Antworten zur Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO
- Löschkonzept nach der DSGVO – so funktioniert es!
- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) einfach erklärt – mit Tipps und Checklisten
Videoüberwachung: Notwendigkeit weiterer Maßnahmen über Zweckfestlegung und Rechtsgrundlage hinaus
Die Festlegung der Zwecke und der Rechtsgrundlage reichen für sich genommen nicht aus, um mit der Videoüberwachung zu beginnen. Auf Grundlage der konkreten Ausgestaltung der geplanten Videoüberwachung gilt es, einige weitere Vorgaben zu beachten und umzusetzen.
Datenschutz-Folgenabschätzung bei Videoüberwachung gemäß Art. 35 DSGVO: Notwendigkeit und Durchführung
Es sollte geprüft werden, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchgeführt werden muss. Die DSFA ist nach Art. 35 Abs. 1 DSGVO allgemein dann verpflichtend, wenn eine bestimmte Datenverarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien. Zentral bei der Durchführung einer DSFA ist die Analyse dieses Risikos sowie die anschließende Ermittlung und Umsetzung passender Abhilfemaßnahmen. Das hohe Risiko ist im Rahmen einer Videoüberwachung aufgrund der systematischen und umfangreichen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche (Art. 35 Abs. 3 lit. c oder der Erfassung besonderer Datenkategorien) schnell erreicht.
Technisch-organisatorische Maßnahmen festlegen
Unabhängig von der DSFA müssen grundsätzlich angemessene technische und organisatorischer Maßnahmen („TOM“) getroffen werden, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten (vgl. Art. 32 DSGVO). Grundsätzlich gilt: Je höher die Risiken der Videoüberwachung sind, desto höher sollte das Schutzniveau der Maßnahmen sein. Dieses hängt zum einen von den Kriterien ab, die auch im Rahmen der Interessenabwägung (siehe oben II. 2.) berücksichtigt werden, zum anderen aber auch von dem Risiko einer unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Löschung, einer Veränderung, des Verlusts und der Offenlegung der Daten bzw. Aufnahmen. Zu den Maßnahmen können etwa die Schwärzung oder das Verpixeln der Bereiche, deren Aufnahme nicht erforderlich ist, gehören. Wichtig sind auch Sicherheitsmaßnahmen wie die Regelung der Zugriffsrechte oder die Implementierung eines Passwortschutzes. Technische Funktionen, die über die gewöhnliche Videoaufnahme hinausgehen (Zoom, Bewegung der Kamera, Ton oder Erkennungssoftware) sollten möglichst deaktiviert werden. Eine konkrete Regelung zur Speicherdauer von Videoaufzeichnungen enthält die DSGVO nicht. Aufnahmen dürfen jedoch grundsätzlich nur so lange gespeichert werden, wie sie für den festgelegten Zweck erforderlich sind. Die konkreten Löschfristen können demzufolge variieren und hängen von Faktoren wie dem Zweck der Überwachung, den geltenden Gesetzen und den unternehmensinternen Richtlinien ab. In den meisten Fällen dürfte eine Löschung nach spätestens 48 Stunden angezeigt sein, in Ausnahmefällen erst später. Zudem ist es entscheidend, die Betroffenenrechte (Art. 12 ff. DSGVO) zu berücksichtigen: Insbesondere Auskunfts- und Löschanfragen sind schnell und rechtskonform zu bearbeiten.
Informationspflichten bei Videoüberwachung nach Art. 13 und 14 DSGVO
Unternehmen müssen einen entsprechenden Hinweis anbringen, der den Anforderungen des Art. 13 bzw. 14 DSGVO genügt und der die sich im gefilmten Bereich bewegenden Betroffenen informiert über:
- die Videoüberwachung,
- den Verantwortlichen inkl. Kontaktdaten,
- die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden),
- die Rechtsgrundlage (inkl. Nennung der berechtigten Interessen, soweit sich die Nennung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stützt),
- die Zwecke,
- die Speicherdauer oder die Kriterien für die Festlegung der Dauer sowie
- etwaige weitere Empfänger.
Dafür sollte ein gut sichtbares Hinweisschild mit einem entsprechenden Piktogramm und den weiteren, o.g. Informationen vor dem überwachten Bereich angebracht werden. Je nach Konstellation können neben dem Hinweisschild, auf dem nur ein Überblick über die Informationen gegeben werden kann, ergänzende Hinweisblätter ausgelegt werden, in denen die Informationen noch einmal detaillierter dargestellt werden. Zudem muss die Videoüberwachung sorgfältig und umfassend dokumentiert werden, nicht zuletzt um als Verantwortlicher seinen Rechenschaftspflichten (vgl. Art. 5 Abs. 2 DSGVO) nachkommen zu können. Dazu gehören alle Umstände, das heißt die technische und organisatorische Ausgestaltung der Videoüberwachung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und ggf. die DSFA. Die Informationen sollten in das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) aufgenommen werden. Im VVT ist grundsätzlich für jede Kamera ein gesondertes Verfahren anzulegen.
Spezialrechtliche Anforderungen bei Videoüberwachung: Mitarbeitende und besondere Datenkategorien nach DSGVO
Je nach dem überwachten Gelände und den gefilmten Personen können zu den o.g. grundsätzlichen Anforderungen weitere spezialrechtliche Vorgaben hinzukommen. In diesem Zusammenhang ist häufig die Überwachung von Mitarbeitenden zu nennen. Diese stellt aufgrund des Ober- und Unterordnungsverhältnisses von Arbeitnehmenden und Vorgesetzten, durch die erhöhte Drucksituation und die mögliche Kontrolle des Arbeitsverhaltens einen wesentlich stärkeren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar als etwa bei kurzzeitigen Videoaufnahmen vorbeigehender Passant:innen oder von Kund:innen in einem Ladengeschäft. Hier ist jedoch immer zu berücksichtigen, wie die genauen Umstände der Überwachung sind. Je nach Positionierung der Kamera und der Dauer der Überwachung entstehen auch hier deutliche Unterschiede. Unzulässig ist die Überwachung persönlich besonders sensibler Bereiche wie Umkleiden oder Aufenthaltsräume sowie von Orten, an denen über längere Zeit die Arbeitsleistung erbracht wird. Je weniger unbewachte Räume bzw. Rückzugsmöglichkeiten den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen oder je intensiver eine Überwachung und Kontrolle (auch in Bezug auf Diebstähle o. ä.) der Mitarbeitenden stattfindet, desto eher sind die Videoaufnahmen unzulässig. Zur Vorbeugung von Straftaten ist die Videoüberwachung im Beschäftigtenkontext nur zulässig, wenn für die Begehung der Straftaten konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Auch sollten Unternehmen sich nicht einfach damit „absichern“, eine Einwilligung der Mitarbeitenden einzuholen, da diese häufig an der erforderlichen Freiwilligkeit scheitert. § 26 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) stellt klar, dass die Abhängigkeit der Mitarbeitenden durch das Beschäftigungsverhältnis und die besonderen Umstände der Einwilligung hier berücksichtigt werden müssen. Unternehmen sollten die Videoüberwachung von Mitarbeitern in jedem Fall sehr sorgfältig im Vorfeld prüfen.
Schnell kann es im Rahmen der Videoüberwachung auch zur Verarbeitung besonderer Datenkategorien nach Art. 9 DSGVO kommen, die ebenfalls besonderen Anforderungen im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit unterliegt. Dazu zählt bspw. die Aufnahme biometrischer Daten, wenn das Gesicht oder die Körpergröße genau erfasst werden, oder aber von Gesundheitsdaten, wenn ein Krankenhaus auch nur den Eingang filmt und sich dadurch u.U. ermitteln lässt, wer Patient ist. Die Verarbeitung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten ist grundsätzlich unzulässig und nur in den Ausnahmefällen des Art. 9 Abs. 2 DSGVO erlaubt. Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, kann die Videoüberwachung daher nicht mehr nur aufgrund eines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen, sondern es muss ein Ausnahmefall des Art. 9 Abs. 2 DSGVO erfüllt sein. Wenn besondere Datenkategorien zudem umfangreich verarbeitet werden, muss nach Art. 35 Abs. 3 lit. b DSGVO zwingend eine DSFA durchgeführt werden.
Geplante Novellierung des BDSG zur Videoüberwachung öffentlicher Räume
Derzeit ist eine Novelle der Vorschriften zur Videoüberwachung im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Arbeit. Das BDSG regelte in § 4 dabei die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume, unabhängig davon, ob sie durch eine öffentliche oder eine nichtöffentliche Stelle erfolgt. In einem Urteil vom 27.03.2019 (hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) festgestellt, dass für die Vorschrift kein Raum sei, soweit sie die Videoüberwachung durch nichtöffentliche Stellen betreffe. Vielmehr müsse sich die Videoüberwachung durch nichtöffentliche Stellen allein nach Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO richten. Dieser Entscheidung folgend hat der Gesetzgeber nunmehr im August 2023 einen Referentenentwurf vorgelegt, in dem die Videoüberwachung in § 4 BDSG allein auf öffentlich zugänglich Räume durch öffentliche Stellen beschränkt sein soll. Sollte diese Änderung im Prozess des Gesetzgebungsverfahrens weiterhin Bestand haben, dürften dies in der Praxis jedoch wenig Auswirkungen haben. Denn die Zulässigkeit der Videoüberwachung durch nichtöffentliche Stelle knüpft dann an die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an, wonach die Videoüberwachung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich sein muss und schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen dürfen.
Videoüberwachung im Spannungsfeld von Sicherheit und Datenschutz: Effektive und rechtskonforme Lösungen für Unternehmen
Zusammenfassend kann die Zulässigkeit von Videoüberwachungen nur im Einzelfall abschließend beurteilt werden, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die technischen Möglichkeiten der Kameras, die überwachten Bereiche und Personen sowie die Interessen und vernünftigen Erwartungen von Unternehmen an die Videoüberwachung müssen in Einklang mit den Grundrechten und Interessen der beobachteten Personen gebracht werden. Die Behörden nehmen den Datenschutz bei der Videoüberwachung sehr ernst. Die Implementierung ist ein Balanceakt zwischen Sicherheitsbedürfnissen und Datenschutzanforderungen. Wie unser Beitrag zeigt, ist es möglich, Videoüberwachung rechtskonform zu gestalten und gleichzeitig die Unternehmensinteressen zu wahren. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, um diese Herausforderungen zu meistern. Wir sorgen dafür, dass Sie die komplexen Datenschutzvorschriften nicht nur einhalten, sondern auch proaktiv nutzen können, um das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden zu stärken. Kontaktieren Sie uns, um eine individuelle Beratung zu erhalten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Gemeinsam finden wir den optimalen Weg, um Ihre Videoüberwachung effektiv und datenschutzkonform zu gestalten.
-
Digital Operational Resilience Act (DORA): Umsetzung der Anforderungen durch professionelle Beratung
In einer Welt, in der Cyber-Attacken und IT-Pannen zu den größten Bedrohungen für den Finanzsektor geworden sind, ist proaktives Handeln keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Der europäische Gesetzgeber hat dies mit der Einführung des Digital Operational Resilience Act (DORA) klar zum Ausdruck gebracht. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung.
-

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) einfach erklärt – mit Checkliste zum Download
Wer muss ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) erstellen? Wie wird er aufgebaut? Wie oft muss das VVT aktualisiert und überprüft werden? In welcher Form und Sprache muss das VVT geführt werden? Eine Übersicht mit Checklisten und Tipps.
-
Effektive Datenschutz-Risikoanalysen: Anwendungsbereiche und Vorteile des Threat Modeling
In Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen können Unternehmen durch die Mitigation von Datenschutzrisiken nicht nur sich selbst und ihre Beschäftigten vor Bedrohungen bewahren, sondern vor allem auch den Schutz ihrer Kund:innen effektiver gewährleisten. Ein Schlüsselelement der Risikoanalyse ist das sogenannte Threat Modeling. Wir erläutern, was Threat Modeling beinhaltet und wie es speziell in der Datenschutzberatung eingesetzt wird.
